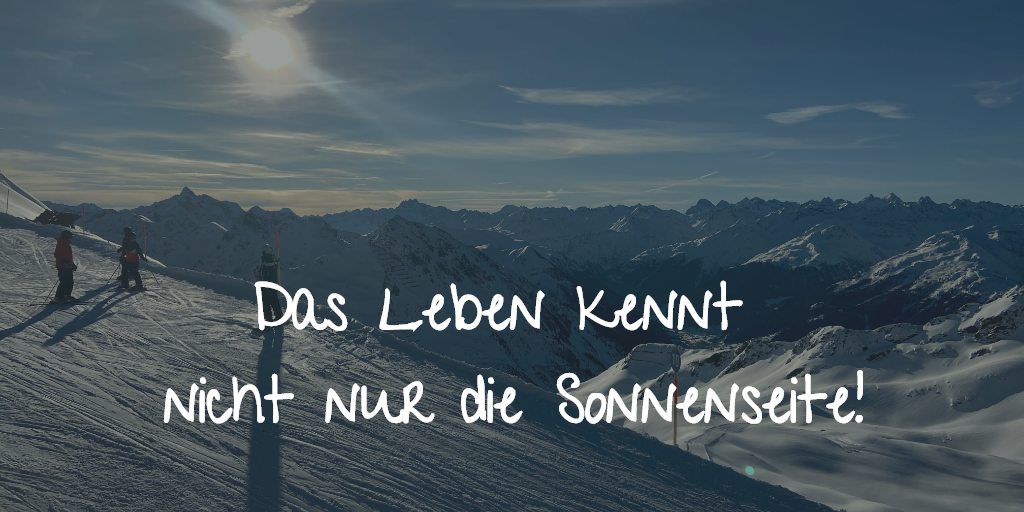Eine solche Skiwoche habe ich noch nie erlebt: Der Wetterbericht und die Sturmwarnungen machten schon im Voraus klar, dass „Schönwetter Skifahrer“ auf wenig Schneestunden kommen würden.
Das schönste Wetter wäre wohl für An- & Abreisetag zu erwarten, ergab unsere kurze Analyse. Und so gab es dann vorletzten Samstag um 5 Uhr Tagwache und um 5.30 Uhr gings mit vollgepackter Familienkutsche los Richtung Lieblingsskigebiet im Montafon.
Nach zwei ganz ordentlichen Skitagen war es Zeit für den Besuch von Sabine – am Montag stand alles still, am zweiten Sturmtag drängten wir uns gefühlt mit dem ganzen Montafon an die zwei geöffneten Skilifte.
Über mangelnde Abwechslung konnte sich keiner beklagen: Jeder Tag anderes Wetter, andere Schneeverhältnisse, Talabfahrt abwechselnd mit oder ohne Wanderintermezzo …
Was sich ziemlich konstant hielt: Die erste Abfahrt am frühen Morgen war die schönste! Ob frisch verschneite Hänge oder perfekt präparierte Pisten – wir waren uns einig: Der Lohn ist gross für den, der bereits um 8.15 Uhr an der Bahn steht.
Wie zu erwarten war: Das schönste Wetter kam zum Schluss. So verbrachten wir auch den Abreisetag auf der Piste und tankten (doch) noch einige Sonnenstunden.
Mehr als Sonnenschein
Ich liebe es, bei besten Bedingungen – sprich: Sonne, gute Sicht, toller Schnee, perfekt präparierte Pisten – mit langezogenen Schwünge die Hänge herunterzubrettern.
Trotzdem wurde mir an diesem wunderschönen Samstag bewusst: Wären alle sieben Skitage so gewesen, hätte selbst dieses „Perfekte“ etwas Ermüdendes gehabt. Immer nur Sonne – auch das wird irgendeinmal langweilig.
Das Abenteuer war jedenfalls in dieser Skiwoche um einiges höher als im Schönwetter-Urlaub: Wie weit können wir heute die (offiziell gesperrte) Talabfahrt auf den Skis bewältigen? Welche Lifte sind heute geöffnet? Wo ist eigentlich Piste – und wo Nebel? …
Wunderbar waren die Abfahrten im Pulverschnee: Harte Piste mit paar wenigen Zentimeter Neuschnee – ein Gefühl vom Fliegen kam auf.
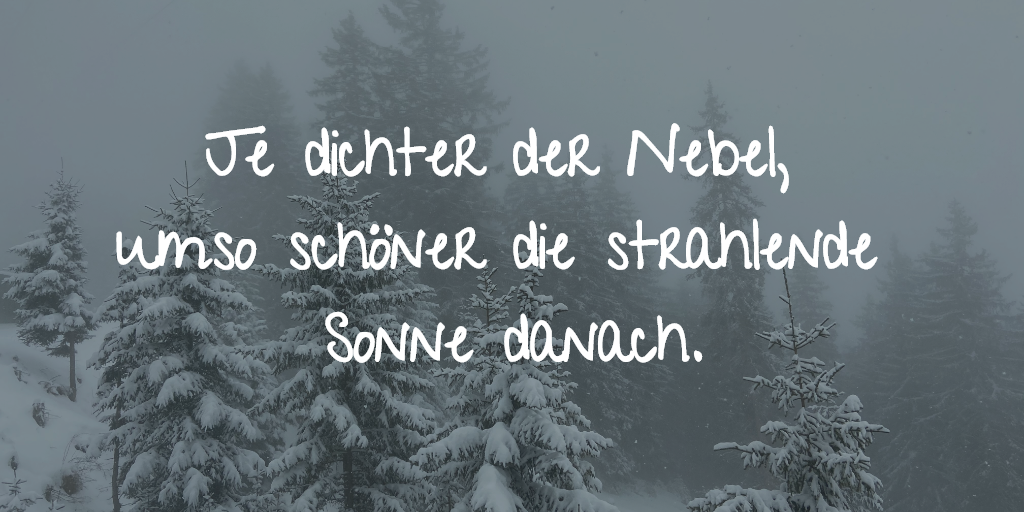
Natürlich liebe ich auch im Leben, wenn die Sonne scheint! Alle sind happy, die Projekte gehen alle gut von der Hand, die eigenen Kinder machen gerade mehr Freude als Ärger und in der Partnerschaft fliegen die Schmetterlinge.
Auf der anderen Seite ist es so mühsam, wenn man im Nebel herumirrt und nicht weiss, wo einem das Leben als nächstes hinträgt: Beziehungsknatsch, Kündigung, gesundheitliche Einschränkungen, Selbstzweifel, übergrosse Herausforderungen und erdrückende Verantwortung …
Ich ertappe mich hin und wieder beim Gedanken, dass ich mir mehr Zeit zum Geniessen wünsche – mehr Zeit an der Sonne, mehr Gelassenheit, mehr unbekümmerte Momente mit guten Menschen und weniger „unter Strom stehen“, weil schon wieder das nächste Projekt, die nächste Hürde oder auch einfach die nächste auszufüllende Steuererklärung warten.
Möglicherweise geht es vielen von uns ähnlich – und es ist wichtig und gut, wenn wir diese Stimme in uns ernst nehmen.
Und doch: Ich will kein Schönwetter-Leben! Ich wünsche mir ganz viele Schönwetter-Momente in meinem Leben, aber das Leben finden nicht nur an der Sonnseite statt.
Und das ist gut so!
Wer meint, das Leben bestünde nur aus Schönwetter, wird die Sonne eines Tages nicht mehr geniessen können.
Je dichter der Nebel, umso schöner die strahlende Sonne danach.
Nein, ich suche nicht das Leid im Leben und ich wünsche es auch keinem. Tatsache ist aber, dass leidvolle Momente, Stürme, Herausforderungen, Brüche zum Leben dazugehören.
Ich wünsche uns, dass wir an diesen Stürmen nicht zerbrechen, sondern dass sie uns stärken und reifen lassen.
Damit wir dann die Sonne in vollen Zügen wieder geniessen können!
Glücksaufgabe
Welcher Sturm in deinem Leben hat dich zu einer reiferen Persönlichkeit gemacht?
Wie kannst du selbst für eine gesunde Ausgewogenheit zwischen Sturm (Herausforderungen) und Sonnenschein (Genussmomente) in deinem Leben sorgen?