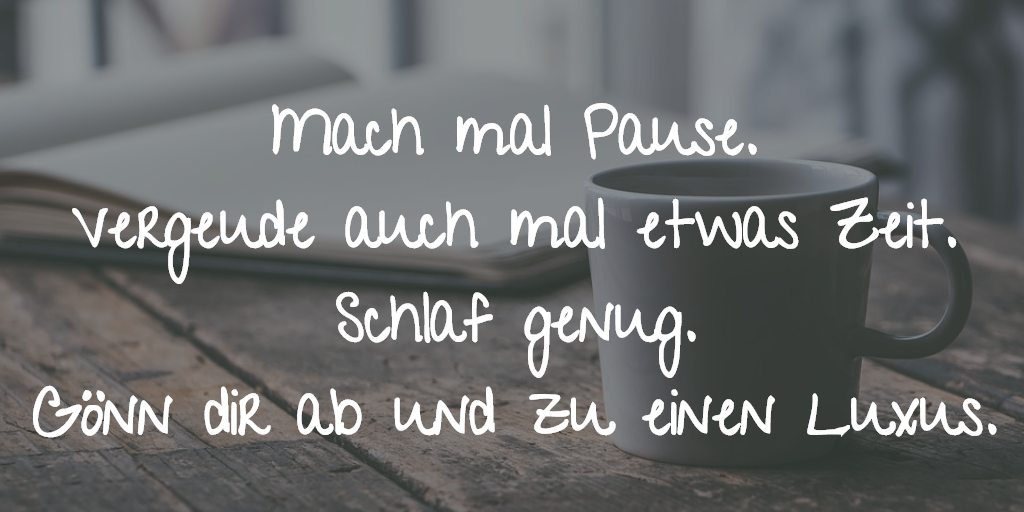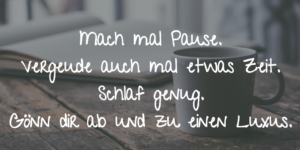Was war das wieder für eine Woche? Da poppte beispielsweise am Mittwoch auf meinem Smartphone die Meldung „Die Übersicht: Das müssen Sie über die brasilianische Corona-Variante wissen.“ auf.
Nachdem wir jetzt fast ein Jahr über das Corona-Virus sprachen und schon mehrmals meinten, wir bekämen es so oder anders in den Griff, beschäftigen wir uns inzwischen mit der britischen, einer südafrikanischen und nun also auch mit der brasilianischen Variante.
Und: Obwohl man ja derzeit kaum reist, sind alle drei Varianten schon bei uns angekommen. Bekommen wir das Virus mit all seinen Mutanten so in den Griff? Fraglich.
Wie bleibe ich optimistisch?
Irgendwie – wenn man jetzt kein Epidemiologe ist und eher bildlich an die Sache herangeht – bekommt man den Eindruck, dass da irgendwo eine fiese Corona-Familie sitzt und sich schon den übernächsten Streich (oder Schlag) im Krieg gegen die Menschheit ausheckt.
Man wird das Gefühl nicht los: Wir hinken immer wieder ein, zwei Schritte hinterher.
Auf Ende Januar 2021 war eine grössere Veranstaltung angesagt, die ich organisiere. Nach dem Motto „Die Hoffnung stirbt zuletzt“ hofften wir anfangs Herbst noch, die Konferenz durchführen zu können.
Doch die Hoffnung schwand und die Motivation, etwas vorzubereiten, das nicht durchgeführt werden kann, schwand etwa im gleichen Mass.
Inzwischen steht ein neuer Termin (Ende August). Wird es diesmal klappen? Oder wiederholt sich das Ganze einfach nochmals?
Das Schöne an der aktuellen Situation: Es geht allen gleich. Planungssicherheit gibt es nicht.
Ich will nicht schön reden, was nicht schön ist. Aber ich will in allem optimistisch bleiben. Denn: Eine motivierende Zukunftsperspektive ist ein wichtiger Glücksfaktor:
«Optimismus und Hoffnung schützen uns gegen Depression, wenn uns Schicksalsschläge treffen, sie verhelfen uns zu einer besseren Arbeitsleistung […] und schenken uns bessere körperliche Gesundheit.»
Martin Seligman, Begründer der Positiven Psychologie
Wo ist das Pony?
Ein gesunder Umgang mit der Zukunft hat mit positiven Emotionen bezüglich dem Künftigen zu tun und drückt sich in Zuversicht, Vertrauen und auch Selbstvertrauen aus.
Aber Achtung: Den Optimismus, von dem hier die Rede ist, sollten wir nicht mit positivem Denken verwechseln. Das Motto «Alles wird gut, wenn ich es mir nur genug wünsche» erscheint einem kritischen Zeitgenossen aus gutem Grunde zu einfach.
Doch auch der Realist lebt besser, wenn er mit Zuversicht auf die vor ihm liegenden Tage schaut und nicht alles Kommende bereits im Voraus mit einem düsteren Grau übertüncht.
Dazu, wie wir den Optimismus nicht verlieren, hörte ich kürzlich an einer Sitzung folgende tolle Kurzgeschichte:
Eltern von eineiigen Zwillingen machten einmal einen interessanten Test: An einem Geburtstag gaben sie ihren Kindern – eines war Pessimist, das andere Optimist – ihre Geschenke in verschiedenen Zimmern.
Das pessimistische Kind bekam das beste Spielzeug, das die Eltern finden konnten. Dem optimistischen Kind schenkten sie eine Kiste voller Pferdemist.
Voller Neugier warteten die Eltern auf die Reaktionen der Zwillinge.
Das pessimistische Kind schimpfte: Dieses Spielzeug hat eine hässliche Farbe. Damit spiele ich nicht!
Im anderen Zimmer warf das optimistische Kind den Pferdemist lachend in die Luft und rief: „Ihr könnt mich nicht reinlegen! Wenn hier so viel Mist ist, gibt es auch irgendwo ein Pony.“
Elisabeth Mittelstädt, in „Gute Woche!“
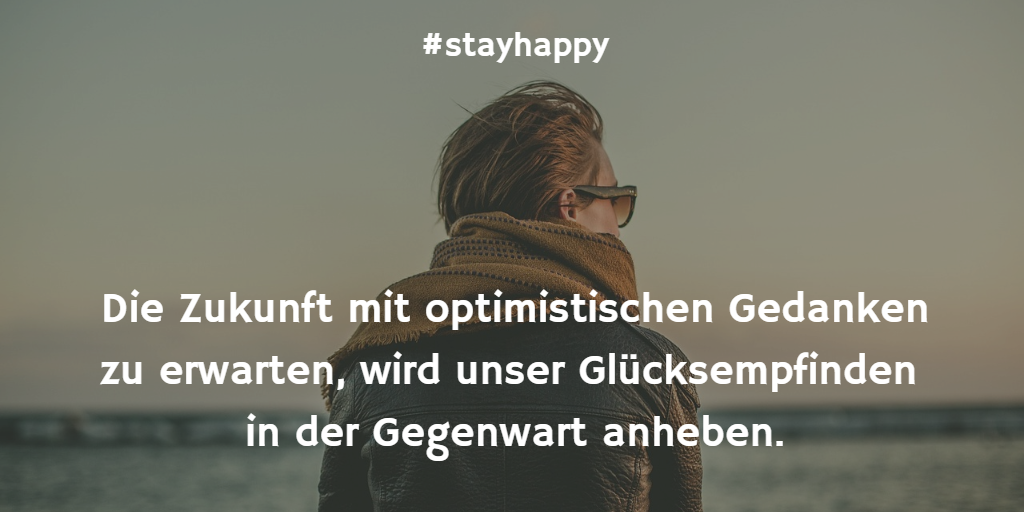
Tanke Hoffnung!
Suche nach dem Pony!
Glücksaufgabe
Meine Hoffnung hat mit meinem Glauben zu tun. Auch die Glücksforschung hat herausgefunden: Glaube macht glücklich! Unter anderem, weil im gelebten Glauben eine motivierende Zukunftsperspektive in der Hoffnung auf Gott gut begründet ist.
Was nährt deine Hoffnung?
Und hier noch einen TV-Tipp passend zur Pony-Geschichte: Aus Mist Dünger machen, Fenster zum Sonntag Talk mit Georges Morand.
(Ausstrahlung 13./14. Februar 2021 auf SRF oder online)