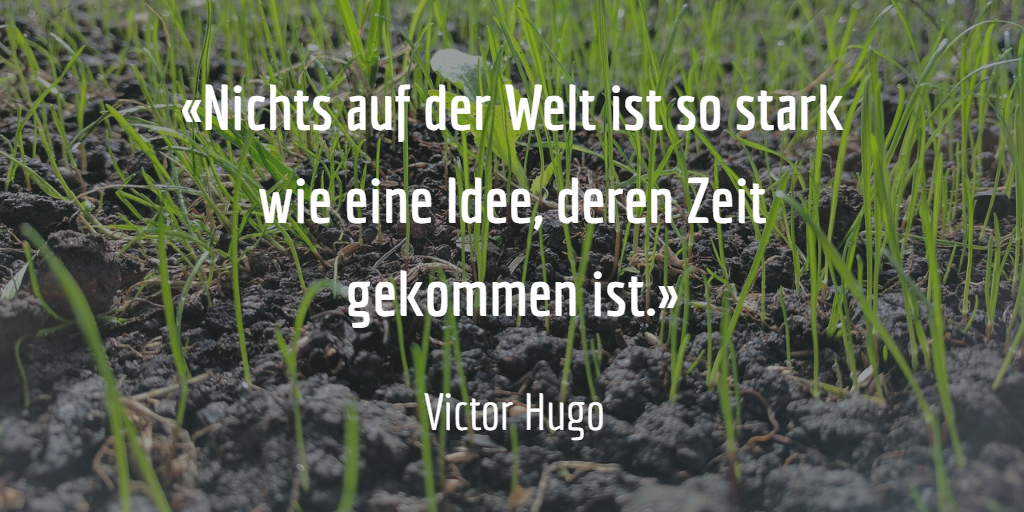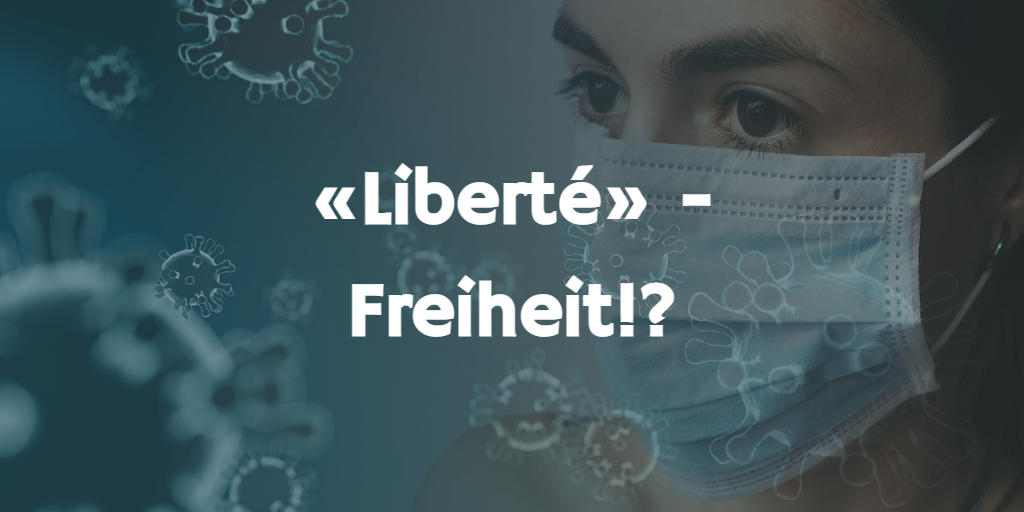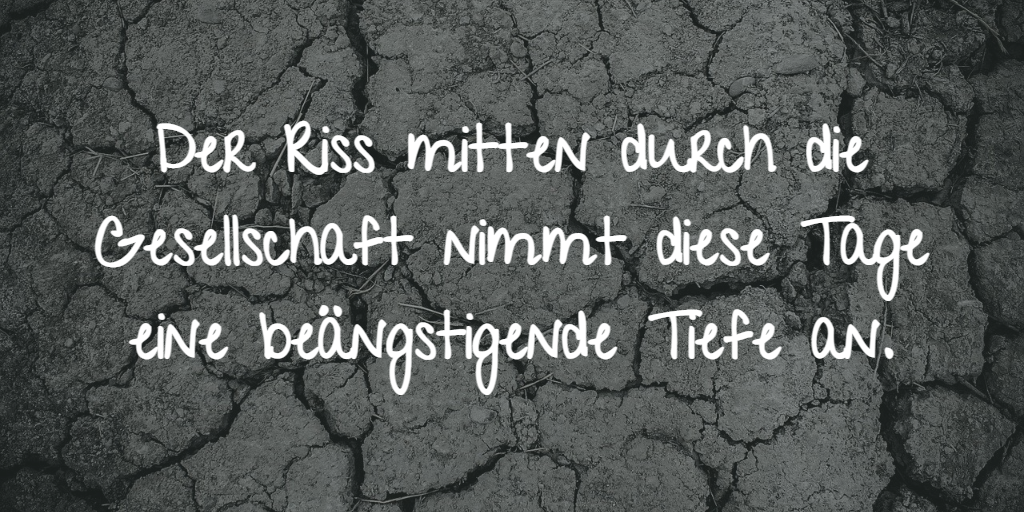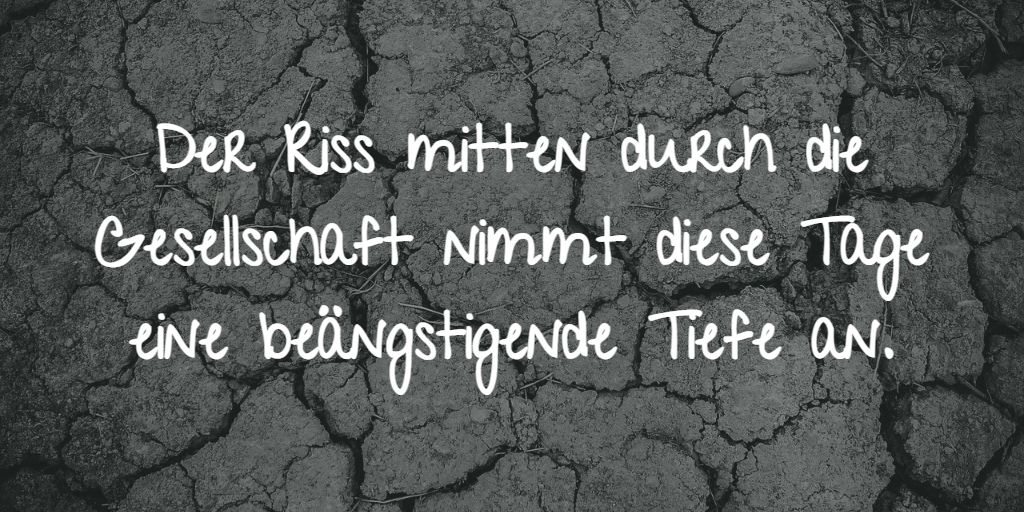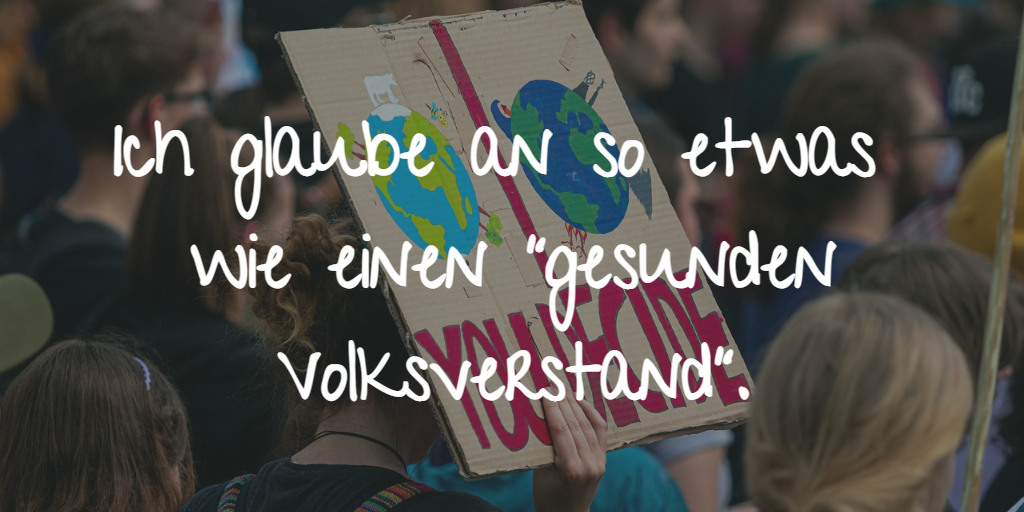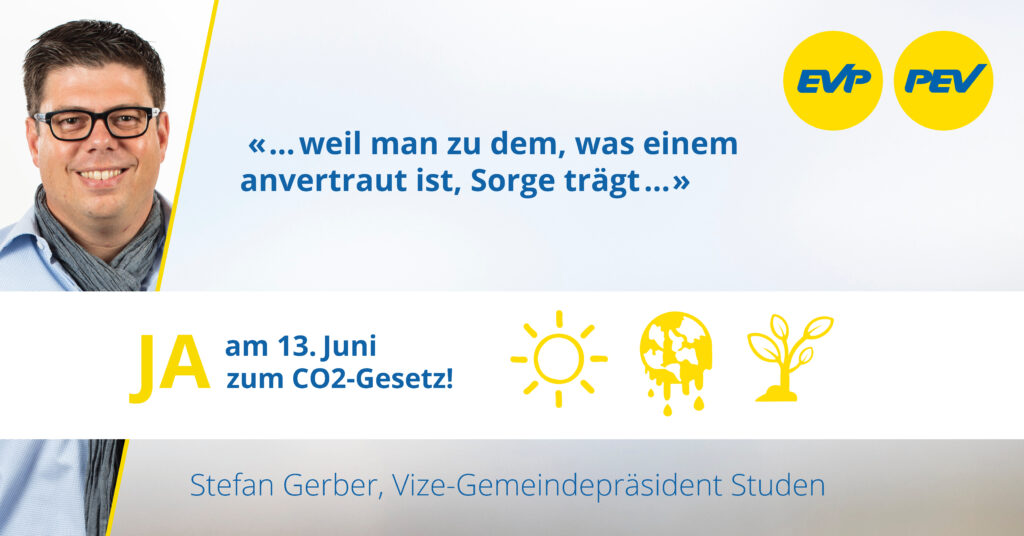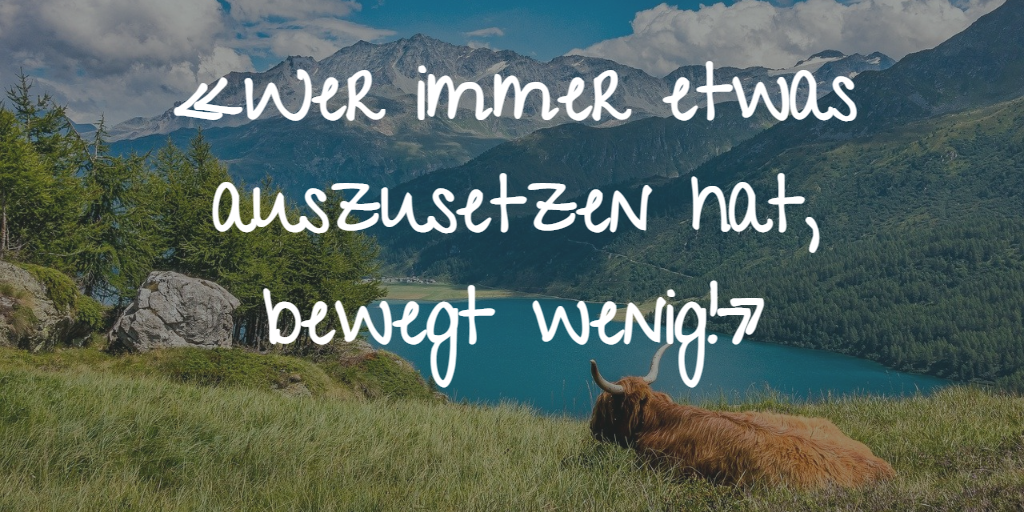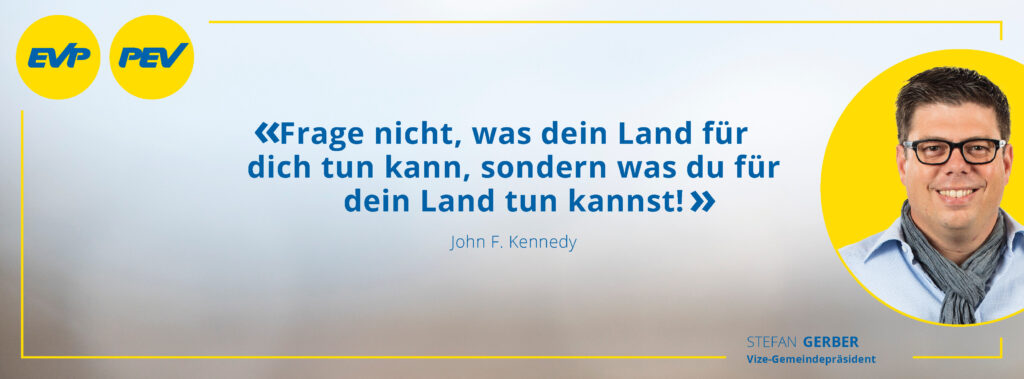Heute schreibe ich von einer Graswurzelbewegung, von welcher ich in den letzten zwei Wochen Teil sein durfte.
Gras was? Graswurzelbewegung. So nennt man Initiativen von Privatpersonen, die sich zusammen tun und unkompliziert einer Krise begegnen wollen. Oder wie es Wikipedia ausdrückt: «Graswurzelbewegung (englisch grassroots movement), auch Basisbewegung, ist eine politische oder gesellschaftliche Initiative (Bewegung), die aus der Basis der Bevölkerung entsteht (Basisdemokratie).»
Leider sind die Umstände, aus denen diese Initiative startete, mehr als tragisch: Der Krieg in der Ukraine und das Schicksal der vielen Menschen auf der Flucht hat in meiner Frau den Impuls ausgelöst, eine Sammelaktion zu starten.
Diese Idee war eine Antwort auf die gms Matinée unter dem Motto «Niemanden zurücklassen», unserem Gottesdienst Ende Februar. Wir wollten unseren guten Gedanken auch gute Taten folgen lassen.
So begann Brigä (meine Frau) also mit Abklärungen: Was wird benötigt? Mit welchem Hilfswerk können wir zusammenarbeiten? Wie machen wir auf die Aktion aufmerksam? Wer würde uns beim Sortieren und Verpacken helfen?
Ich wiederum war berührt, wie schnell und konkret der Verein Unihockey für Strassenkinder durch sein Netzwerk in der Ukraine durch Geldüberweisungen sofort Nothilfe leisten konnte.

Und so entschieden wir uns für eine zweiteilige Aktion: An zwei Sammeltagen nahmen wir Kleider- und Hygieneartikel-Spenden entgegen. Gleichzeitig sammeln wir Geldspenden für Unihockey für Strassenkinder.
Wir nutzten die Kanäle von unserem Verein Happy Kids für die Kommunikation, hatten hier auch Vorstand und Mitarbeitende mit an Bord geholt. Jedoch verzichteten wir durch die gegebene Dringlichkeit auf einen «Hochglanzflyer» – und stellten im Nachhinein fest, dass wir nicht mal unsere Kontaktdaten abdruckten. Nur: Was, wann, wo.
Via Newsletter und vor allem über Social Media begannen wir die Aktion zu teilen. Und dann fingen die Graswurzeln an zu spriessen – und wie!!
Der eigenen Ohnmacht begegnen
Im Sport würde man sagen, das Momentum war auf unserer Seite. Oder nach Victor Hugo: «Nichts auf der Welt ist so stark wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist.»
Viele Menschen waren in der ersten Kriegswoche tief betroffen und wollten irgendwie helfen, dadurch konnten sie ihrer eigenen Ohnmacht etwas entgegensetzen. Zusätzlich war das Hilfsgüter-Sammeln medial gerade ein grosses Thema.
Viele Leute in unserem Netzwerk haben den Flyer der Aktion in ihrem WhatsApp-Status geteilt – und so hat sich wie eine Graswurzel unsere Reichweite über Nacht um ein Vielfaches erweitert: Plötzlich haben Freunde von Freunden von Happy Kids Mitgliedern an ihrem Ort Hilfsgüter zu sammeln begonnen.
Nach nur drei Tagen Vorlauf war es soweit: Wir durften an zwei Tagen von sehr vielen Menschen aus nah und fern eine Unmenge an Kleider, Schuhen, Decken und extra eingekauften Hygieneartikeln entgegennehmen. Es kam zu teils sehr rührenden Begegnungen mit Familien, die Waren brachten, oder Menschen, die einen persönlichen Bezug zur Ukraine haben.
Wir hatten für die zwei Tage immer zwischen sechs und acht freiwillig Mitarbeitende fürs Sammeln, Sortieren und Verpacken eingeteilt. Aber das reichte bei weitem nicht. Zeitweise bedeckten die abgegebenen Säcke und Kisten den gesamten Vorplatz unserer Location.
Und so kam es, dass wir nicht mehr Kleiderspenden brauchten, sondern weitere Mitarbeitende.
Das war für mich das Eindrücklichste und wohl das besonders charakteristische einer Graswurzelbewegung: Menschen, die wir nicht kannten, boten spontan ihre Hilfe an. Eine Frau, beispielsweise, brachte am ersten Tag Kleider vorbei, gab uns ihre Handy-Nummer und bot sich als Helferin an. Am zweiten Tag war sie dann fünf Stunden im Einsatz.

So gibt es ganz viele Dinge, die ineinander hineinspielten. Als das Hilfswerk, mit dem wir zusammenarbeiten wollten, plötzlich keine Kapazität mehr hatte, mussten wir auf die Schnelle weitere Hilfswerke kontaktieren. Ein grosses Transportfahrzeug hatten wir im voraus organisiert – das reichte jedoch nicht. Auch dafür gab es Menschen, die selber aktiv wurden und eine Lösung fanden.
Oder die Marketingabteilung von Energie Seeland AG, Lyss, die uns unkompliziert und innert einer Stunde 100 Zügelkisten zur Verfügung stellte.
Es war sehr viel Arbeit und nach dem zweiten Sammeltag und den weitergegebenen 50 m3 Hilfsgüter war noch lange nicht Schluss: 30 Säcke zurückbehaltener Ware mussten nochmals sortiert und recycelt werden oder hunderte Taschen brauchten eine neue Zweckbestimmung.
Wahrscheinlich ist auch das charakteristisch für eine Graswurzelbewegung: Zeitweise war es sehr chaotisch und spontan musste umdisponiert werden – z.B. weil ein Hilfswerk die Ware in Säcken und nicht in Kisten wollte …
Aber immer war es sehr erfüllend und ein WOW-Erlebnis.
Eine Idee, die gezündet hat.
Menschen, die sich bewegen liessen.
Liebe statt Hass.
Die Hoffnung, der Not etwas entgegensetzen zu können.
Glücksaktivität
In meinem nun schon 23jährigen Dienst als Pfarrer mag ich mich an 2-3 weitere Aktionen erinnern, die eine solche Dynamik auslösten. Mit anderen Worten: Solche Graswurzelbewegungen sind leider nicht an der Tagesordnung.
Unglaublich, was in so kurzer Zeit auf die Beine gestellt werden kann, wenn Menschen mit Leidenschaft ihre Zeit, Gaben und Möglichkeiten zur Verfügung stellen.
Und ich wünschte mir diese Erfahrung noch viel öfters. Sie macht glücklich! Wo bist du Teil einer solchen Gemeinschaftsbewegung?
Doch in Sachen Gras will ich mich auch an das afrikanische Sprichwort erinnern: «Das Gras wächst nicht schneller, wenn du daran ziehst.» Denn: Nicht jeden Idee zündet auf so gigantische Weise, dass eine Graswurzelbewegung daraus entsteht. Wenn ich mir das bewusst bin, kann ich dem Frust vorbeugen und mich daran freuen, wenn eine Idee wieder einmal richtig reif war.